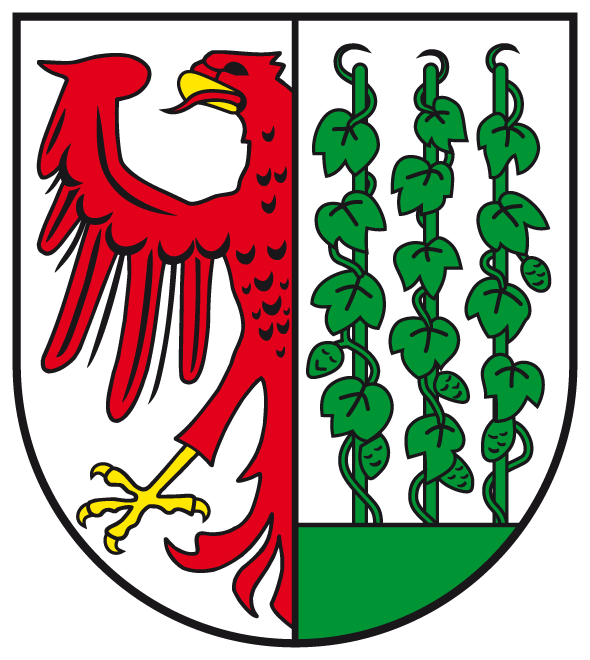Hintergrundinformationen
Etwa 60 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf die Wärme- und Kälteerzeugung. Dafür werden heute hauptsächlich fossile Brennstoffe genutzt. Die Wärmeversorgung ist damit für einen erheblichen Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich, sei es durch Prozesswärme in Industrie und Gewerbe oder durch Heizungen in Wohngebäuden und kommunalen Einrichtungen.
Der Wärmeplan stellt einen strategischen Fahrplan dar, der aufzeigt, wie öffentliche Gebäude und Privathaushalte in Zukunft klimafreundlich mit Wärme versorgt werden können und in welchen Schritten und mit welchen Maßnahmen dies erreicht werden soll. Ziel ist es, eine CO2-neutrale Wärmeversorgung bis 2045 zu erreichen. Gesetzliche Grundlage für die Durchführung ist das am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz.
Ablauf der Wärmeplanung
Der Planungsprozess der Wärmeplanung ist durch das Wärmeplanungsgesetz vorgegeben und gliedert sich in mehrere Abschnitte.
Eignungsprüfung
Die Eignungsprüfung steht am Anfang der Wärmeplanung. Sie dient dazu die Teilgebiete Gardelegens zu identifizieren, die heute bereits (nahezu) vollständig mit erneuerbaren Energien bzw. unvermeidbarer Abwärme versorgt werden oder die sich nicht für die Wärmeversorgung über ein Wärme-oder Wasserstoffnetz eignen. Für diese Gebiete ist eine verkürzte Wärmeplanung mit reduzierter Datenerhebung ausreichend bzw. keine Wärmeplanung erforderlich.
Bestandsanalyse
Im Zuge der Bestandsanalyse wird der Ist-Zustand der Wärmeversorgung ermittelt. Hierzu werden von der Stadt die Daten zur Ermittlung der aktuellen Wärmebedarfe oder -verbräuche sowie der vorhandenen Wärmeerzeuger und Energieinfrastrukturen, einschließlich der eingesetzten Energieträger erhoben und ausgewertet. Dadurch ergibt sich ein umfassendes Bild der aktuellen Wärmeversorgungssituation Gardelegens.
Potenzialanalyse
Durch die Potenzialanalyse wird geprüft, welche unterschiedlichen Quellen erneuerbare Energien oder unvermeidbarer Abwärme perspektivisch für die Wärmeversorgung zur Verfügung stehen und unter wirtschaftlichen Bedingungen nutzbar gemacht werden können. Das können unter anderem die Nutzung des Wärmepotenzial der Elbe oder von Abwasser sein oder die Erschließung geothermischer oder solarthermischer Potenziale.
Zielszenario und Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete
Auf Grundlage der vorangehenden Analysen erfolgt die Entwicklung des Zielszenarios. Dieses stellt den Entwicklungspfad hin zu einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis 2045 dar. Teil des Zielszenarios ist die Einteilung Gardelegens in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete. Diese Einteilung zeigt für das Zieljahr 2045 und für die Zwischenzieljahre 2030, 2035 und 2040, welche Quartiere in der Stadt beispielsweise zentral über ein Wärmenetz, ein Wasserstoffnetz oder dezentral über eine eigene Anlage im Gebäude (z.B. eine Wärmepumpe oder Pelletheizung) versorgt werden sollen.
Umsetzungsstrategie
Die Umsetzungsstrategie ist ein mit Prioritäten versehener Maßnahmenplan, der beschreibt, mit welchen konkreten Projekten und Maßnahmen das formulierte Zielszenario erreicht werden soll. Die Maßnahmen der Umsetzungsstrategie werden einzelnen Handlungsfeldern zugeordnet (z. B. Ausbau der erneuerbaren Energien, Wärmenetzausbau) und priorisiert. Dabei wird insbesondere ihr Beitrag zur Zielerreichung sowie das geschätzte Kosten-Nutzen-Verhältnis bewertet, um so eine zielorientiere und wirtschaftlich darstellbare Strategie zu erhalten.
Eignungsprüfung
Eignungsprüfung gem. §14 Wärmeplanungsgesetzt im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung der Hansestadt Gardelegen
Einleitung
Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches Instrument zur Sicherstellung einer langfristig nachhaltigen und klimaneutralen Wärmeversorgung. Im Rahmen des Wärmeplanungsgesetzes (§ 14 WPG) soll eine systematische Analyse der Eignung von Teilgebieten für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung durchgeführt werden. Die Eignungsprüfung dient dazu, bereits zu Beginn der Erarbeitung der Wärmeplanung die Gebiete der Hansestadt Gardelegen zu identifizieren, die für den wirtschaftlichen Betrieb eines Wärme- oder Wasserstoffnetzes nicht geeignet sind. In diesen Gebieten ist eine dezentrale Versorgung vorzusehen. Die Eignungsprüfung erfolgt insbesondere auf der Basis vorhandener Nutzungs- und Strukturdaten sowie Daten zur Wärmedichte. Dieser Bericht dokumentiert Methodik, Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Eignungsprüfung. Er dient als Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung der Wärmewende in der Hansestadt Gardelegen.
Methodik
Die Eignungsprüfung wurde auf Grundlage des Leitfadens zur kommunalen Wärmeplanung durchgeführt. Dabei wurden die relevanten Gebiete in der Hansestadt Gardelegen anhand eines klar strukturierten Entscheidungsprozesses analysiert. Der Prozess umfasst die Prüfung der Potenziale für Wärmenetze, Wasserstoffnetze und die Berücksichtigung erhöhter Einsparpotenziale.
Kernkriterien zur Bewertung
Die nachfolgenden Kriterien dienen zur Überprüfung für welche Wärmeversorgung bzw. Maßnahmen sich ein Gebiet eignet.
Wärmenetze:
- Existiert in unmittelbarer Nähe ein Wärmenetz?
- Gibt es relevante erneuerbare Wärmequellen (z.B. Kläranlagen, Abwärme aus Industrie)?
- Zeichnet sich das Siedlungsgebiet durch eine dichte Bebauung aus?
- Sind hohe Wärmedichten (> 100 MWh/ha) erreichbar?
- Sind potenzielle Großabnehmer oder Ankerkunden vorhanden?
Wasserstoffnetze:
- Ist ein Gasnetz vorhanden, das für eine Wasserstoffumstellung geeignet wäre?
- Ist die wirtschaftliche Versorgung durch ein Wasserstoffnetz realistisch?
Erhöhte Einsparpotenziale:
- Sind Gebiete mit hohem energetischen Sanierungsbedarf (vor 1977 errichtete Gebäude) vorhanden?
- Ist das Gebiet bereits als Sanierungsgebiet ausgewiesen?
Vorgehensweise
Die Einteilung der Siedlungsgebiete der Hansestadt Gardelegen in unterschiedliche Eignungsgebiete erfolgt anhand der im Folgenden dargestellten Bearbeitungsschritte
1. Systematische Erfassung von Siedlungsstrukturen, vorhandener Infrastruktur und Wärmebedarfen.
2. Überprüfung der Relevanz von Wärmenetzen und Wasserstoffnetzen.
3. Abwägung erhöhter Einsparpotenziale gemäß § 18 Absatz 5 WPG.
4. Einteilung in Teilgebiete und Zuweisung der folgenden Kategorien:
- (Normale) kommunale Wärmeplanung: Gebiete mit Potenzial für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung.
- Verkürzte kommunale Wärmeplanung: Gebiete mit Fokus auf dezentrale Versorgungslösungen.
- Verkürzte Wärmeplanung in Teilgebieten mit erhöhtem Einsparpotenzial: Gebiete Fokus auf dezentrale Versorgungslösungen und mit hohem energetischen Sanierungsbedarf.
- Keine kommunale Wärmeplanung erforderlich: Gebiete mit (nahezu) vollständiger EE-Wärmeversorgung oder Gebiete ohne Wärmebedarf (z.B. Kleingartenanlagen, Friedhöfe etc.).
Ergebnisse
Das Siedlungsgebiet der Hansestadt Gardelegen wurde in insgesamt 99 Teilgebiete unterteilt. Die Gebiete, in denen eine normale kommunale Wärmeplanung durchzuführen ist, liegen vorwiegend im innerstädtischen Bereich. Bereiche für verkürzte Wärmeplanungen stellen vor allem außerhalb gelegene, dörflich geprägte Ortsteile dar. Die detaillierten Ergebnisse sind im Anhang beigefügt und enthalten spezifische Hinweise für jedes Teilgebiet. Mit der Zuweisung der Teilgebiete zu den unterschiedlichen Kategorien sind in den Wärmeplanungsgebieten allgemeine Maßnahmenempfehlungen verbunden:
Normale kommunale Wärmeplanung:
Gebiete mit hoher Wärmedichte und guter Anbindung an bestehende oder geplante Wärmenetze sollten prioritär in die weitere Planung aufgenommen werden. Die Integration erneuerbarer Energien (z. B. EE-Wärmequellen) und die Identifikation von Abwärmepotenzialen sind zentrale Handlungsschwerpunkte.
Verkürzte kommunale Wärmeplanung:
Gebiete mit geringerer Bebauungsdichte oder fehlender Netzinfrastruktur sollten mit dezentralen Versorgungslösungen, wie zum Beispiel Einzelwärmepumpen oder Biomasseheizungen, eingesetzt werden. Eine gezielte energetische Sanierung der Bestandsgebäude kann diese Maßnahmen unterstützen.
Verkürzte Wärmeplanung in Teilgebieten mit erhöhtem Einsparpotenzial:
In diesen Gebieten sind ergänzend zu dezentralen Versorgungslösungen dezidierte energetische Sanierungsprogramme notwendig. Begleitende Förderprogramme und Beratungsangebote für Eigentümer können dazu beitragen, die Sanierungsrate nachhaltig zu erhöhen. Die Ausweisung von Gebieten für die verkürzte
kommunale Wärmeplanung basiert auf den aktuell vorliegenden Untersuchungsergebnissen. Sollten sich im Zuge der Durchführung der Wärmeplanung Erkenntnisse ergeben, die eine umfassendere Betrachtung bestimmter Gebiete erforderlich erscheinen lassen, wird auch für diese eine normale kommunale Wärmeplanung durchgeführt.
Fortschreibung der Eignungsprüfung
Der kommunale Wärmeplan ist mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen, um neue Entwicklungen in Technologie und Infrastruktur sowie ggf. geänderte rechtliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. In diesem Rahmen ist auch die Eignungsprüfung fortzuschreiben.
- (PDF-Datei: 1.2 MB)
- (PDF-Datei: 72 kB)
Ergebnisse der Bestandsanalyse
BESTANDSANALYSE GEM. §15 WÄRMEPLANUNGSGESETZ IM RAHMEN DER KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG DER HANSESTADT GARDELEGEN
- (PDF-Datei: 14.2 MB)
Einleitung
Im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung wurde für die Hansestadt Gardelegen eine umfassende Bestandsanalyse durchgeführt. Sie bildet die fachliche Grundlage für die Entwicklung einer zukunftsfähigen, klimaneutralen Wärmeversorgung und folgt den Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes (WPG).
Siedlungs- und Gebäudestruktur
Auf Basis des Liegenschaftskatasters, der Zensusdaten 2022 sowie ergänzender Fachdaten der Stadtverwaltung wurden der Gebäudebestand analysiert, klassifiziert und in Teilgebiete unterteilt. Die daraus abgeleiteten Typologien stellen die Grundlage für die Abschätzung von Sanierungspotenzialen sowie für die spätere Auswahl geeigneter Versorgungslösungen dar.
Die Hansestadt Gardelegen weist eine heterogene Siedlungsstruktur auf: Die kompakte Innenstadt ist durch eine dichte Bebauung mit zahlreichen historischen Gebäuden geprägt. In den angrenzenden Wohnquartieren dominieren Ein- und Zweifamilienhäuser, während in den Randbereichen der Kernstadt größere Industrie- und Gewerbestandorte bestehen. Die zahlreichen Ortsteile der Hansestadt weisen kleinteilige, dörflich geprägte Strukturen auf. Der überwiegende Teil des Gebäudebestands der Hansestadt Gardelegen wurde vor 1979 errichtet. Entsprechend hoch ist der Anteil unsanierter Bausubstanz mit energetischem Handlungsbedarf. Neubauten nach 2000 sind nur in wenigen Quartieren vorhanden.
Das Stadtgebiet ist überwiegend durch Wohnnutzung geprägt. Gewerbe- und Industrieflächen konzentrieren sich auf das nördliche und südöstliche Stadtgebiet. Diese funktionale Trennung ist für die spätere Entwicklung sektorenspezifischer Versorgungskonzepte relevant.
Energieträger der Heizungen
Die Analyse der Energieträger der Heizungen erfolgte durch die Zusammenführung von verfügbaren Verbrauchsdaten (u. a. von Netzbetreibern und Schornsteinfegern), Zensusdaten 2022 und modellbasierten Ableitungen. Diese Analyse zeigt die klare Dominanz fossiler Heizsysteme: Erdgas ist der häufigste Energieträger, insbesondere in der Kernstadt. In den Ortsteilen spielen darüber hinaus auch Ölheizungen sowie Biomasseanlagen (v.a. Pelletsheizungen, Holzöfen) eine Rolle. Wärmepumpen sind bislang nur in wenigen Neubauten im Einsatz. Ablesbar ist außerdem die Fernwärmeversorgung im Gebiet rund um die Karl-Friedrich-Wilhelm Wander Grundschule.
Wärmebedarf und Wärmedichte
Die Einteilung der Siedlungsgebiete der Hansestadt. Der gesamte Endenergiebedarf für Raumwärme (Heizung), Warmwasser und Prozesswärme lag im Jahr 2025 bei rund 455 GWh/a. Auffällig ist dabei, dass der größte Anteil mit ca. 251 GWh (55 %) auf den Sektor Gewerbe und Industrie entfällt. Auf Wohnen entfallen ca. 36 % des Endenergiebedarfs.
Die höchsten Wärmedichten in der Hansestadt Gardelegen (> 500 MWh/ha·a) finden sich in der historischen Innenstadt sowie in den angrenzenden Quartieren als auch in einzelnen Gewerbegebieten. Diese Bereiche erscheinen als besonders attraktiv für leitungsgebundene Wärmelösungen.
Energieinfrastruktur und -netze
Die leitungsgebundene Versorgung in der Hansestadt Gardelegen umfasst ein gut ausgebautes Gasnetz sowie eine flächendeckende Stromversorgung. Fernwärme wird bislang ausschließlich im Quartier rund um die Wanderschule bereitgestellt. In den übrigen Stadtbereichen ist derzeit keine Fernwärmeerschließung vorhanden. Eine Wasserstoffinfrastruktur besteht derzeit nicht. Im Rahmen der Wärmeplanung wird die Einrichtung dieser als langfristige Option zur Dekarbonisierung der Industrie und zur Spitzenlastabdeckung in der Wärmeversorgung geprüft.
Treibhausgasbilanz
Die Wärmeerzeugung verursacht im Jahr 2025 rund 107.000 Tonnen CO2-Äquivalente. Der Wohnsektor trägt mit ca. 36.800 Tonnen (34 %) maßgeblich zur Emissionsbilanz bei. Besonders emissionsintensiv sind die fossilen Energieträger Erdgas und Heizöl, die zusammen rund 97 % der THG-Emissionen der Wärmeversorgung der Hansestadt Gardelegen verursachen. Daraus ergibt sich ein erhebliches Minderungspotenzial durch die Dekarbonisierung des Wärmesektors, insbesondere in Bereichen mit hohen Wärmedichten und fossiler Dominanz.
Fazit
Die Bestandsanalyse der Hansestadt Gardelegen bildet die fachliche Grundlage für alle weiteren Schritte der Kommunalen Wärmeplanung. Sie zeigt den hohen Anteil unsanierter Gebäude, die klare Dominanz fossiler Heizsysteme sowie erhebliche THG-Emissionen im Wärmebereich. Gleichzeitig identifiziert sie Bereiche mit hohen Wärmedichten und bestehender Infrastruktur als geeignete Ansatzpunkte für zukünftige Versorgungslösungen. Damit schafft sie die Voraussetzung für die Entwicklung eines treibhausgasneutralen Zielszenarios und die anschließende Maßnahmenplanung.
- (PDF-Datei: 14.2 MB)
Veröffentlichung des Entwurfs des Wärmeplans
Die Hansestadt Gardelegen erstellt als planungsverantwortliche Stelle einen kommunalen Wärmeplan für das Stadtgebiet. Auf Grundlage des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) beteiligt die Hansestadt Gardelegen in diesem Rahmen auch die Öffentlichkeit.
Gemäß § 13 WPG wird der Entwurf des Wärmeplans für die Dauer eines Monats (mindestens 30 Tage) im Internet veröffentlicht sowie zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt. Innerhalb dieser Frist können Stellungnahmen abgegeben werden. Die eigegangenen Stellungnahmen werden geprüft und in die Abwägung einbezogen.
Ihre Stellungnahme können Sie bis zum 10.02.2026 einreichen. Hierfür können Sie das Beteiligungsportal Sachsen-Anhalt (beteiligung.sachsen-anhalt.de) oder die folgende E-Mail-Adresse nutzen: gardelegen@ar-climatepositive.de.
Ebenfalls ist es möglich, die veröffentlichten Unterlagen in der Zeit vom 10.01.2026 bis einschließlich 10.02.2026 in der Stadtverwaltung der Hansestadt Gardelegen, Rudolf-Breitscheid-Str. 3, Haus II, Stabsstelle Strategische Stadtentwicklung, Zimmer 211, 39638 Hansestadt Gardelegen einzusehen und Stellungnahmen persönlich abzugeben.
- (PDF-Datei: 19.7 MB)
Förderung durch die Nationale Klimaschutzinitiative
Die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung der Hansestadt Gardelegen wird durch die Nationale Klimaschutzinitiative gefördert. Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasmissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
Weitere Informationen unter: www.klimaschutz.de